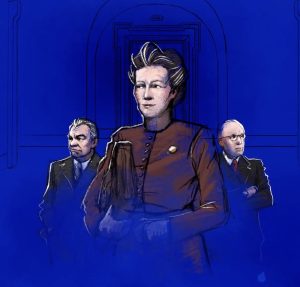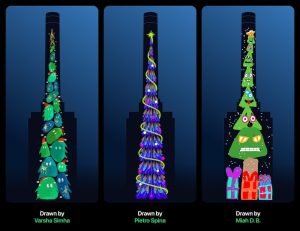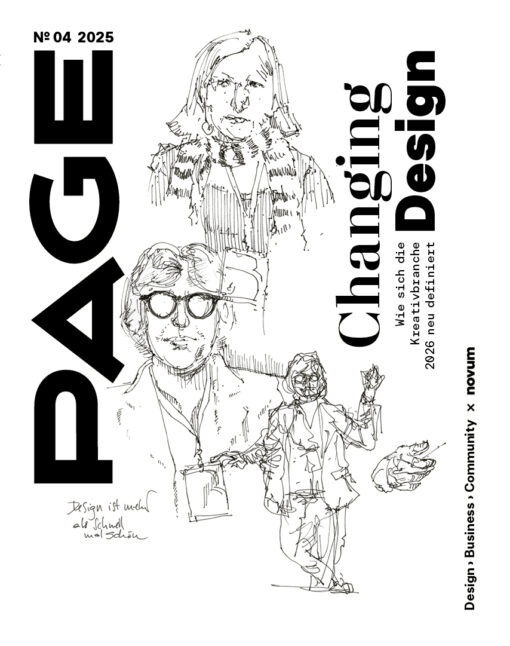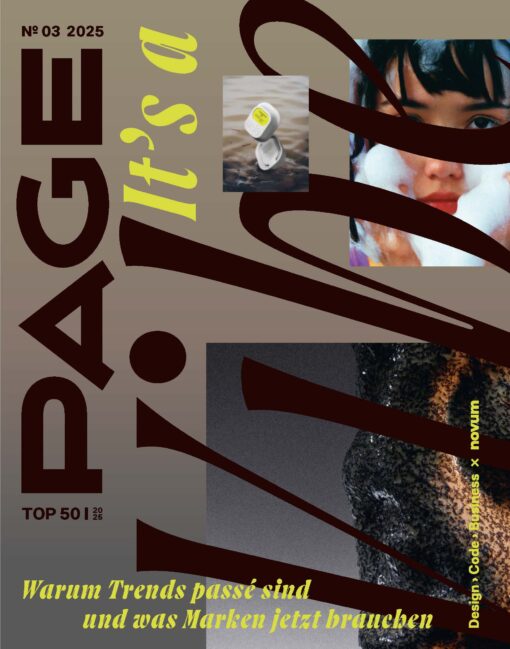Christoph Niemann ist einer der derzeit berühmtesten deutschen Illustratoren. Mit seiner Kolumne für die »New York Times« überrascht und berührt er immer wieder aufs Neue – sei es thematisch oder durch neue Formate. Wir sprachen mit ihm über Neuanfänge und andere Herausforderungen.

Credit: Gene Clover
»Wenn man keine Fehler macht, versucht man etwas nicht richtig«, so Christoph Niemann am 14. November auf der Furore in Hamburg, einer Veranstaltung von Markenfilm, die in diesem Jahr unter dem Motto »Risiko« stand. Gleichzeitig distanzierte sich der Illustrator von dem Trend, Scheitern zu verherrlichen. »Fehler zu machen ist kein Spaß. Es tut weh.« Dennoch gehören Fehler und Unsicherheiten laut Niemann zum kreativen Schaffensprozess. Bleiben sie aus, drohen Trott und Mittelmäßigkeit.
Das ist auch ein Grund, warum der erfolgreiche Illustrator mit seiner Familie von New York City nach Berlin zog. »Veränderungen erzeugen eine enorme Energie«, sagt Niemann. Wir sprachen mit ihm über Neuanfänge und andere Herausforderungen für heutige Gestalter.
PAGE: Warum haben Sie New York verlassen?
Niemann: In New York ist alles auf Kante geplant. Das ist toll, wenn man ein Buch produziert und klar ist, dass alle Deadlines eingehalten werden müssen. Gleichzeitig schränkt das aber freies Arbeiten ein. Oft entstehen tolle Arbeiten erst durch Umwege – und die kann man sich bei engen Zeitplänen nicht leisten. Mein Buch »Abstract City« über New York habe ich zum Beispiel komplett in Berlin gemacht.
Wird es ein solches Buch bald auch über Berlin geben?
So bald sicher nicht. Ich muss erst wieder neue Geschichten und Erfahrungen sammeln, meinen Kopf wieder auffüllen. Deshalb bin ich auch umgezogen.
Sie sind häufig Protagonist Ihrer Illustrationen. Fällt es Ihnen schwer, sich selbst zu zeichnen?
Überhaupt nicht. Ich habe anhand von Selbstporträts gelernt, Gesichter zu zeichnen. Wenn ich eine Person zeichne, sieht sie meistens aus wie ich. Die Selbstporträts haben auch den Grund, dass es leichter ist, sich über sich selbst lustig zu machen. Ich möchte nicht mit dem Finger auf Leute zeigen, die sich im Flugzeug daneben benehmen, sondern meine eigenen Erfahrungen schildern. Im besten Fall erkennen sich die Menschen darin wieder und können auch über sich selbst lachen.
Zu Beginn Ihres Studiums wollten Sie die volle Bandbreite Ihres zeichnerischen Könnens ausspielen. Wie schwer war es für Sie, sich auf den reduzierten Stil zu konzentrieren, für den Sie heute berühmt sind?
Als mein Professor mir sagte, mein Portfolio sei Mist und wahre Stärke entstünde durch Reduktion, hat das mein Weltbild zerstört. Aber ich habe mich dennoch entschieden, weiter zu machen und schließlich meinen Stil gefunden. Heute reizt es mich, aus wenig viel zu machen. Visuelle Orchester dienen oft dazu, eine schlechte Idee zu verstecken. Es ist wie im Film: Explosionen und Visual Effects können sehr beeindruckend sein – aber wenn die Idee dahinter schlecht ist, sind es nur leere Effekte.
In letzter Zeit haben Sie auch Animationsvideos gemacht – etwa für Google (You and Your Browser) und für Ihre Kolumne in der New York Times (Tribute to Maurice Sendak) – und sogar eine eigene App (Petting Zoo). Wie wichtig ist es für einen Gestalter, neue Technologien kennenzulernen?
Die App ist als freies Projekt entstanden. Als ich mit der Idee, wie das Ganze aussehen und funktionieren sollte, zu professionellen Programmierern gegangen bin, haben mir alle gesagt: »Das geht so nicht. Du musst ein Video machen.« Daraufhin habe ich mich selbst in die Technik reingestürzt, was wirklich nicht leicht war. Nach etwas sechs Monaten hatte ich es endlich geschafft, eine erste Animation so zu coden, wie ich es mir vorstellte. Als ich damit zu den Programmierern ging und mit den entsprechenden Fachtermini argumentieren konnte, hieß es plötzlich: »Kein Problem, das machen wir für dich.«
Interessant. Eigentlich sollen Programmierer ja die Lösungen finden, um visuelle Ideen umzusetzen.
Zumindest ich habe es nicht so erlebt. Wir als Designer müssen auf die Ingenieure eingehen – nicht andersherum. So ist nun mal die Hierarchie. Wir müssen zumindest ein Stück weit ihre Sprache beherrschen, damit sie verstehen können, was wir wollen. Außerdem ist es unglaublich hilfreich, die Parameter zu kennen, um zu wissen, was möglich ist – und was eben nicht. Wenn man mit dieser Denke an Projekte herangeht, tun sich ganz neue kreative Möglichkeiten auf. So war es zum Beispiel bei »Der Fluch von Maracana«, meinem interaktiven Essay für die New York Times über die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist ein ganz neues Format, für das ich tief in die Technik einsteigen musste.
Furore ist ein Veranstaltungsformat von der Hamburger Produktionsfirma Markenfilm. In kleinem Rahmen stellen dort Kreative jeder Couleur sich, ihre Arbeiten und Arbeitsweisen vor – stets persönlich, emotional und inspirierend. Neben Christoph Niemann waren bei der Furore IV unter anderen auch der Fotograf Daniel Josefsohn, Framestore-Gründer Mike McGee und MTV-Legende Ray Cokes vor Ort. Mehr Informationen und Eindrücke vom Event gibt es unter http://furore.markenfilm.de/