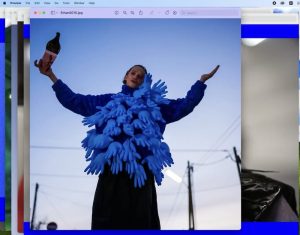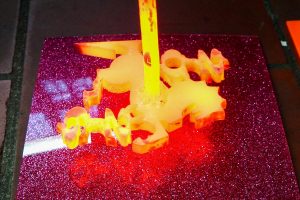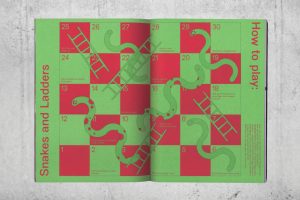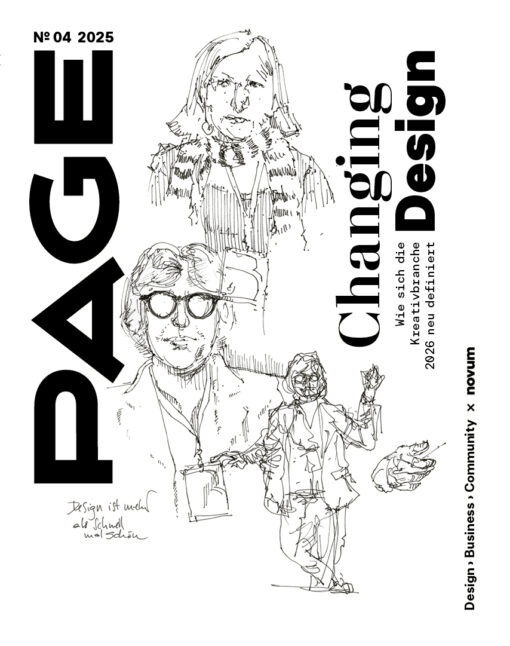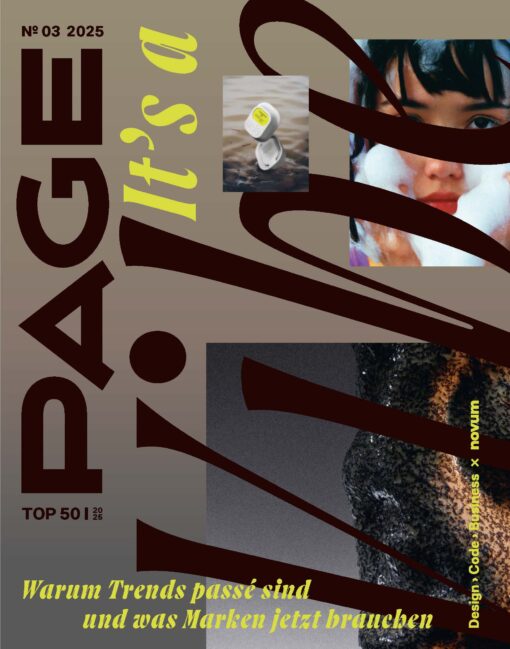»Die Zeiten, in denen die Arbeit von Designern vor allem auf eine Steigerung von Produktion und Konsum abzielt, sind vorbei«, sagt Kris Krois, Professor an der Freien Universität Bozen. Deshalb ist beim neuen Master Eco-Social Design alles anders.

Kris Krois, Associate Professor an der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen, hat gemeinsam mit seinen Kollegen den Master Eco-Social Design ins Leben gerufen, der im Oktober 2015 startet. Wieso, weshalb, warum erklärt er im Interview.
PAGE: Worum geht es beim Master in Eco-Social Design?
Kris Krois: Das Besondere an unserem Master ist vor allem, dass er auf ein Themengebiet ausgerichtet, nicht auf eine Designdiziplin. Es geht um ökosoziale Entwicklung und die Rolle die Designer dabei spielen. Dabei richten wir den Blick auf lokale Gemeinschaften und Wirtschaftskreisläufe, aber immer vor dem Hintergrund einer globalisierten Welt.
Dafür braucht es viele Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen und eine 360°-Perspektive statt nur einer fachlichen Spezialisierung wie es bei vielen anderen Masterstudiengängen der Fall ist. Deshalb bringen wir verschiedene Designdisziplinen zusammen und reichern sie an mit Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.
Wir wollen die ökosoziale Transformation vorantreiben und Designer ausbilden, die im Dienst der Gesellschaft handeln statt nur im Dienst der Industrie.
Warum ist so ein Studiengang notwendig?
Die Konsumorientierung bringt unsere Gesellschaft an ihre ökologischen und sozialen Grenzen. Es braucht neue Muster des Wirtschaftens und Lebens – und wir glauben, dass Designer hier eine wichtige Rolle spielen. Dabei geht es nicht in erster Linie um ökoeffizientere Produkte, sondern um Lebensstile, Werte und Politik im weitesten Sinne.
Die Zeiten, in denen die Arbeit von Designern vor allem auf eine Steigerung von Produktion und Konsum abzielt, sind vorbei. Viele Gestalter sind auf der Suche nach einem erweiterten Sinn für ihre Tätigkeit.
War es schwierig, den Master akkreditieren zu lassen?
Ja. Das Ganze hat drei Jahre gedauert und wir sind zwei Mal gescheitert. Jetzt hat es endlich geklappt und im Oktober kann es losgehen. Bei dem Prozess haben wir viel gelernt und konnten ein großes Netzwerk an Unterstützern, Interessenten, Forschern, Designern und Partnern aufbauen – vor allem dank der Konferenzen »By Design or by Desaster« 2013 und »Glocal Design Spring« 2015. Wir sind auf viel positives Feedback und Interesse gestoßen und glauben, mit dem Thema den Zeitgeist zu treffen.
Sie nennen das Studium radikal projektorientiert. Was bedeutet das genau und wieso haben Sie diesen Ansatz gewählt?
Wir sind überzeugt, dass sich Theorie und Praxis am besten in konkreten Projekten verschränken lassen.
Auch Projektmanagement lernt man am besten, indem man Projekte macht – und nicht im Theorie-Kurs »Wie funktioniert Management?«. Deshalb definieren die Studenten bei uns ihre eigenen Projekte und setzen sie dann mit unserer Unterstützung um. Die Tätigkeit aller Lehrenden besteht zu 50 Prozent aus Projektbetreuung. Außerdem helfen wir den Studenten dabei, den richtigen Mix aus Fächern für ihr Projekt zusammenzustellen.
Welche Fächer sind das zum Beispiel?
Im Bereich »Skills & Technologies«, bieten wir die Fächer Informationsdesign, Web & Motion Design, Interface Design, Digital Design & Fabrication, Materialkunde und Produktionsprozesse, aber auch Design Research. Der Bereich »Discourse & Science« vermittelt neben sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen auch Fähigkeiten im Bereich Moderation und Partizipation.
Das Fach Ökosoziale Wirtschaft deckt Managementkompetenzen ab sowie alternative Unternehmensformen und wie man sie konkret umsetzen kann. Um dem Ganzen eine Klammer zu geben, formulieren wir für das jeweils erste Studienjahr ein offenes Thema wie Essen oder Mobilität. Dafür holen wir uns Experten aus Unternehmen, Organisationen oder anderen Universitäten an Bord, die uns in diese Themen einführen und eventuell als Projektpartner einsteigen.
Warum konzentrieren Sie sich auf lokale Projekte?
Hier haben wir mehr Gestaltungsspielraum als bei internationalen Großkonzernen. Außerdem sind sie meist per se nachhaltiger, weil lokal produziert wird und die Transportwege kürzer sind. Man darf das nicht falsch verstehen:
Wir propagieren nicht die Rückkehr in vorindustrielle Zustände.
Es geht vielmehr darum, neue Technologien und Kollaborationsmöglichkeiten zu nutzen, um nachhaltige Projekte zu fördern. Dabei spielen etwa das Maker Movement, Open Source Technologien, Upcycling und Co-Working eine große Rolle. Im Idealfall dienen die Projekte als Exempel, die sich global adaptieren lassen.
Wie kann das konkret aussehen?
Das Projekt Nu Volante von dem Designstudenten Raphael Volkmer ist exemplarisch. Er hat in seiner Abschlussarbeit an der Fakultät Design & Künste das Potenzial erkannt, das entfaltet werden kann, wenn er zwei ganz unterschiedliche Akteure zusammenbringt: Einerseits senegalesische Straßenhändler, die es mit viel Charme schaffen in den Straßen Bozens Dinge zu verkaufen, die eigentlich keiner haben will. Andererseits die Sozialgenossenschaft AKRAT, in der benachteiligte Menschen aus gebrauchten Dingen neue Produkte herstellen.
Die Straßenhändler sind genial in Vertrieb und Marketing. AKRAT kann produzieren. Raphael hat also eine Serie von Produkten gestaltet, die AKRAT gut herstellen kann und die sich für den Verkauf auf der Straße eigenen. Dazu hat er eine entsprechende Marke und Kommunikation gestaltet. Inzwischen arbeitet er gefördert durch den Bund der Genossenschaften (Legacoop) an der Umsetzung.
Das Projekt zeigt eindrücklich, wie sich die Rolle des Designers erweitert: Er gestaltet nicht nur ein Produkt und eine Marke, sondern ein System.
Sinnvoll sind natürlich auch ganz andere Projekte, z.B. die Konzeption und gestalterische Begleitung von Bürgerhaushalten in Gemeinden – inklusive Informationsvisualisierungen, der Gestaltung von Meinungsfindungs- und Abstimmungsprozessen im Rahmen von Veranstaltungen, aber auch via einer Web-Plattform mit entsprechenden Features.
Das ist eine Menge Arbeit. Dürfen die Studenten auch in Gruppen zusammenarbeiten?
Wir ermutigen sogar dazu. Wir erlauben auch durchaus, dass sich die Studenten in einem Bereich spezialisieren – wie etwa Web Design. Aber sie müssen immer übergreifend denken , konzipieren und zusammen arbeiten.
In Gruppenarbeit fördern wir interdisziplinäre Kollaboration zwischen unterschiedlichen Spezialisten, z.B. Web- und Interface-Designern, Produktdesignern, Designforschern, Technikern und Autoren. In den Projekten mit externen Partnern wird die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Bürgerinitiativen, Handwerkern und vielen anderen geübt.
Gibt es ähnliche Angebote an anderen Hochschulen?
Es gibt Studiengänge wie Creative Sustainablity, Eco oder Social Design. Aber gerade letzteres kann so ziemlich alles heißen. Wir sagen klar:
Unser Fokus liegt nicht (nur) auf »grüneren« Produkten. Das wäre zu kurz gedacht.
Es geht vielmehr darum, eine Kultur zu schaffen, die weniger Produkte braucht. Unser Credo lautet: Weniger Dinge, mehr gutes Leben.
Was können die Master-Absolventen anschließend machen?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Ein Weg ist sicherlich der des Social Entrepreneurs, wie ihn Raphael Volkmer gerade geht. Sie können aber auch klassische Designerpositionen in Unternehmen besetzen – und dabei immer ökosoziale Gesichtspunkte berücksichtigen. Der Markt für diese Fähigkeiten und Denkweisen wächst. Viele Marken und Produkte positionieren sich entsprechend, wie etwa das Fairphone. Das ist nicht technisch besser, sondern ethisch – und findet seine Abnehmer.
Sie sollen gewappnet sein, mit Komplexität gut umzugehen.
Unsere Absolventen werden einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, die komplette Produktionskette im Blick haben ebenso wie die kulturellen und sozialen Zusammenhänge. Natürlich können sie keine Experten auf jedem Gebiet sein – aber sie werden wissen, für welche Themen man Experten benötigt und wie man mit ihnen eine produktive Zusammenarbeit organisiert.
An wen richtet sich das Angebot? Was müssen Bewerber mitbringen?
Hauptsächlich an Bachelorabsolventen aller Facetten von Design – sei es Produkt, Kommunikation, Interaktion usw. – aber auch an solche ohne Designhintergrund, wie Sozialwissenschaftler oder Ingenieure.
Wichtig ist, dass auch sie ein Portfolio mit konkreten Projekten vorweisen können. Natürlich werden letztere in den zwei Jahren keine perfekten Designer werden, aber sie werden ihr Wissen um die Methoden und Potentiale des Design gewinnbringend als Manager, Berater oder Unternehmer einsetzen können.
Was kostet das Studium?
Die Freie Universität Bozen ist eine öffentliche Hochschule und erhebt die italienischen Standardstudiengebühren in Höhe von 1343,50 Euro pro Jahr. Dafür bietet sie exzellent ausgestattete Werkstätten und Projekträume sowie ein gutes Zahlenverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden. Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Studierenden und stehen in intensivem Austausch.
Mehr zum Thema:
Für den Master Eco-Social Design, der im Oktober 2015 startet, kann man sich noch bis zum 8. Juli bewerben. Alle Informationen dazu gibt es unter http://designdisaster.unibz.it/MA/.
Ein weiteres Interview zur Rolle des Designers und wie sie sich in der Ausbildung niederschlägt, lesen Sie hier: »Design-Studium: Was Gestalter lernen müssen«
Wir widmen uns dem Thema »Ausbildung für die Kreativbranche« ausführlich in PAGE 8.2015, die Sie ab 25. Juni in unserem Online-Shop bestellen können!