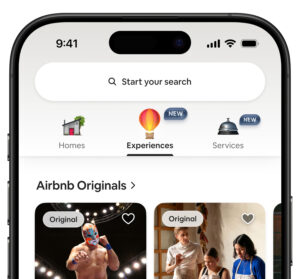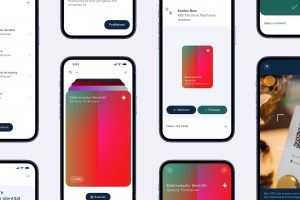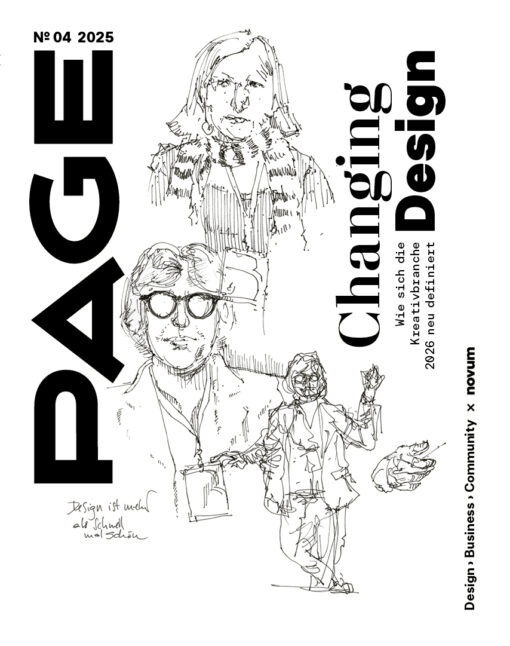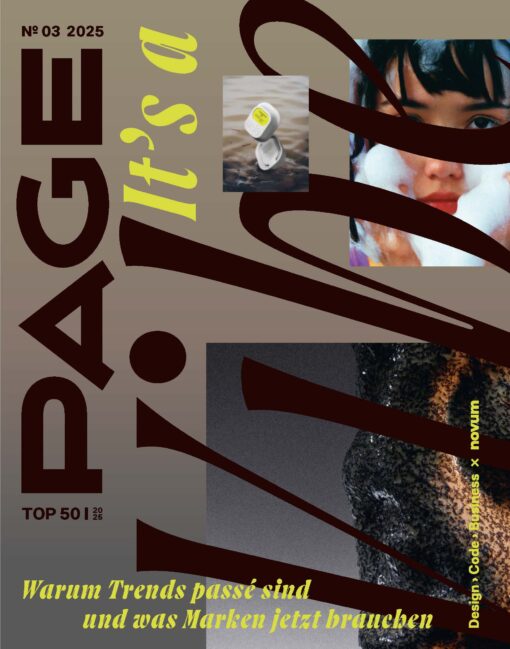San Francisco, Farooq und die Verlagswelt
Immer zum Erscheinen der aktuellen Printausgabe der PAGE: »Die Fundstücke« von Jürgen Siebert. Freuen Sie sich über kühne Kommentare zu Trends, Entwicklungen, Ereignissen und dem ganz normalen Alltagswahnsinn eines Kreativen … Heute: die Zukunft mobiler sozialer Kommunikation.

Immer zum Erscheinen der aktuellen Printausgabe der PAGE: »Die Fundstücke« von Jürgen Siebert. Freuen Sie sich über kühne Kommentare zu Trends, Entwicklungen, Ereignissen und dem ganz normalen Alltagswahnsinn eines Kreativen … Heute: die Zukunft mobiler sozialer Kommunikation.
Das US-E-Book-Fundstücke-Portal findings interviewte Anfang April den Internetexperten Clay Shirky zur Zukunft des Verlagswesens. Wie gewohnt stellt dieser kurz und klar fest: »Das Verlegen verändert sich nicht, es verschwindet. Bislang bezeichnete der Begriff einen Kader von Geschäftsleuten, die den unglaublich schwierigen, umständlichen und teuren Vorgang des Publizierens auf sich nehmen. Doch Publizieren ist heute kein Job mehr, sondern eine Taste. Da gibt es einen Knopf, der ›Publish‹ heißt, und wenn du den herunterdrückst, ist es passiert.«
Clay Shirky spielt auf ein Phänomen an, das nicht nur die Verleger, sondern auch die Musikindustrie, die Softwarehersteller, Filmverleiher, Zeitungen und Zeitschriften betrifft, also Einrichtungen, die zwischen Urheber und Konsument vermitteln. Ihre Rolle wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern … oder sie müssen aufgeben. Zum einen weil die User ihre »Ware« direkt beim Urheber beziehen, zum Beispiel über Websites, Facebook oder Twitter. Zum anderen werden Empfänger zu Sendern, weil die Technik alles für sie so einfach macht, das Fotografieren, das Schreiben, das Veröffentlichen …
Diesen Wandel, also das direkte Kommunizieren zwischen Anbieter und Kunde, konnte ich bei einer Reise nach San Francisco am eigenen Leib erfahren. Taxifahren macht dort keine Freude, weil es zu wenig Wagen gibt. Die New Yorker Designerin Tina Roth Eisenberg (aka swissmiss) verabschiedete sich auf Twitter so von der Stadt: »Hey San Francisco, I will totally miss your good coffee and healthy snacks. But man, can you stock up on cabs?« Erik Spiekermann antwortete darauf: »You need to get the Uber app!« Ich probierte den Service noch am selben Tag auf dem Weg zum Flughafen aus.
Die Erfolgsgeschichte von Uber basiert auf mobiler sozialer Kommunikation. Die App vermittelt private Kfz-Personenbeförderungen als Alternative zu einer – meist mangelhaften – Taxiversorgung. In San Francisco sind rund 200 Partner mit ihren Wagen angeschlossen, überwiegend Teilzeitkräfte, Studenten oder Fahrer, die sich privat etwas dazuverdienen möchten. Sie benötigen dafür lediglich ein adäquates Auto sowie ein Apple- oder Android-Smartphone.
Kunden laden sich die kostenlose App, in der sie sich registrieren und ihre Kreditkartendaten hinterlegen. Zum Antritt einer Fahrt dient die grüne »Set Pickup Location«-Taste. Uber ermittelt den Standort, findet den nächsten freien Wagen und vermeldet binnen Sekunden die Abholung, die meist innerhalb von fünf Minuten erfolgt. Dabei wird keine anonyme Wagennummer angekündigt, sondern der Name des Fahrers mit Foto dazu erscheint ein »Call Driver«-Button.
Nach fünf Minuten also bog Farooq von der Mason in die O’Farrell Street ein, mit einem GMC und dem Kennzeichen 1ZZX734. Für Fahrten zu Flughäfen gelten an allen Uber-Standorten feste Tarife, die höher liegen als für eine gewöhnliche Taxifahrt. Ein Grund hierfür ist, dass bereits Trinkgeld enthalten ist. Ein anderer dürfte sein, dass sich Uber gar nicht erst mit den Taxivereinigungen anlegen möchte und zu Recht davon ausgeht, dass Fluggästen der Komfort ein paar Dollar mehr wert ist. Am Ende der Fahrt musste ich weder Geldbörse noch Kreditkarte zücken. Farooq brauchte auch keine Quittung schreiben, denn diese erscheint automatisch auf meinem iPhone-Bildschirm und wenige Sekunden später in meinem E-Mail-Postfach.
Zurück in Berlin probierte ich das deutsche Gegenmodell myTaxi aus. Wie schon der Name nahelegt, ist der Service hierzulande an gesetzliche Voraussetzungen gebunden, zum Beispiel einen »Führerschein zur Fahrgastbeförderung«. Ohne die Taxi-Innung läuft hier gar nichts.
Das bestätigt mir auch Dirk Kaya, mein erster myTaxi-Fahrer, der dem Dienst seit zwei Wochen angeschlossen ist. Auch er wurde mir, nach einem Fingertipp auf die »Bestellen«-Taste, mit Namen angekündigt und erschien fünf Minuten später vor der Haustür. MyTaxi haben sich die Hamburger Sven Külper und Niclaus Mewes nach einer Kneipentour in München ausgedacht, als ihnen eine halbe Stunde lang kein Taxi begegnete. Sie entwickelten ihre App mit GPS-Ortung, auch hier werden Fahrer und Bewertung angezeigt und die Anfahrt lässt sich über den Bildschirm verfolgen.
Über 7000 der 180 000 deutschen Taxifahrer nutzen die Software bereits. Dafür zahlen sie rund 1 Euro pro vermittelte Fahrt. Dirk Kaya verrät mir, dass die Funkzentralen »in heller Aufregung« seien wegen der App und per E-Mail Stimmung dagegen machten. Das helfe ihm aber nicht weiter, denn er müsse mit der Zeit gehen. »Ohne myTaxi komme ich an bestimmte Fahrten nicht heran, das kann ich mir nicht leisten.« Auch die Telekom und die Daimler-Tochter car2go glauben an die Zukunft des Hamburger Start-ups und investierten 2011 ganze 10 Millionen Euro in den deutschen Taxi-App-Marktführer.
Inzwischen sind auch deutsche Taxizentralen aufgewacht und haben eigene Apps entwickelt, die freilich nur in ihrer Stadt und mit den eigenen Wagen funktionieren. Dies wird den Erfolg des überregionalen myTaxi-Angebots kaum aufhalten, denn nichts hassen Smartphone-User mehr als verschiedene Apps für die gleiche Aufgabe. Die Taxi-Unternehmen stehen damit vor einem ähnlichen Problem wie die Buchverlage oder die Plattenindustrie: Branchenfremde haben früh eine übergreifende Lösung gefunden, die sich durchsetzt und proprietären Angeboten ein Schattendasein beschert.
Das könnte dich auch interessieren