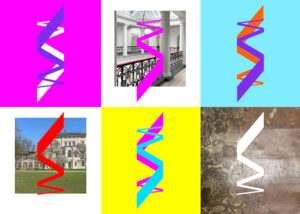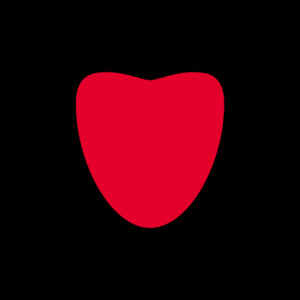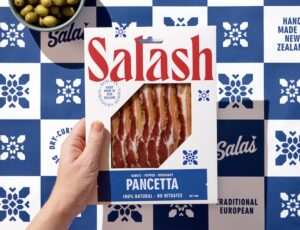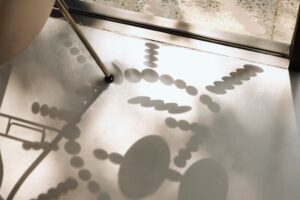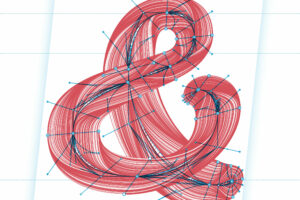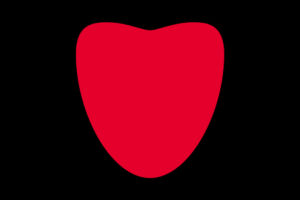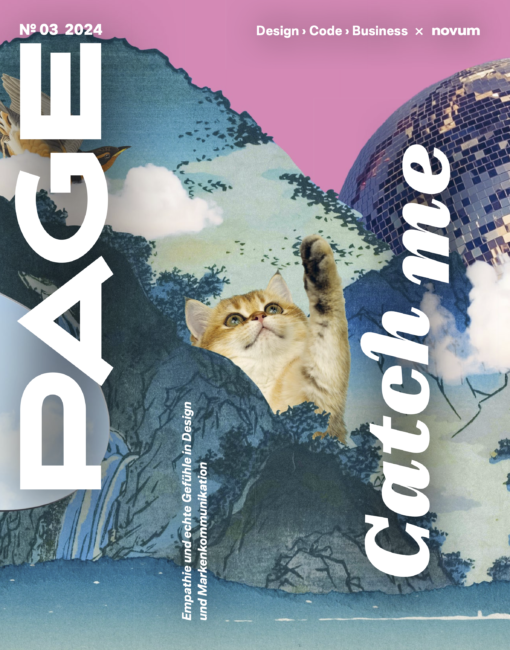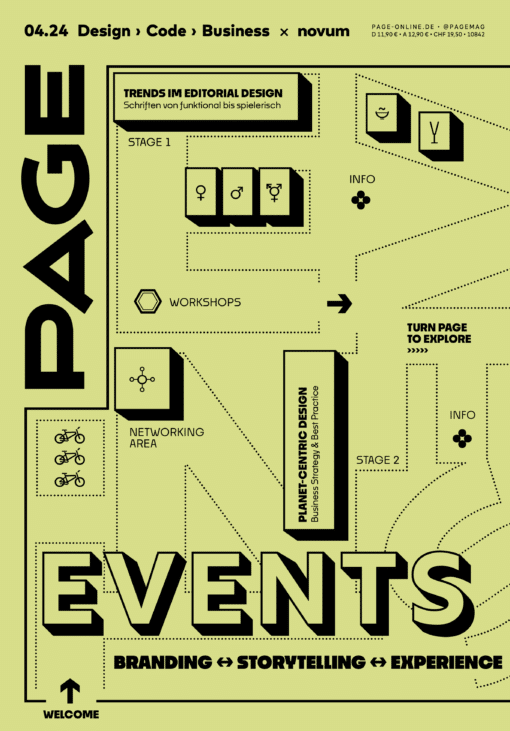Blended Types
Unser lateinisches Alphabet ist zunehmend Einflüssen aus anderen Kulturen ausgesetzt – was ihm gar nicht schlecht bekommt.

Unsere Welt ist voller unterschiedlicher Schriftsysteme – was sich mittlerweile auch im Internet abbildet. Typedesigner suchen ständig nach eigenständigen Formen für neue Fonts. Eine Möglichkeit, unserem vertrauten lateinischen Alphabet neue Impulse zu geben, ist das »interkulturelle Blending« – das Verschneiden mit Schriftformen außereuropäischen Ursprungs. Eine Reihe von Absolventen der Masterkurse in Reading und Den Haag oder Designern, die den Spagat zwischen unterschiedlichen Kulturen in der Praxis machen, gehen diesen Weg.
Hier eine ergänzende Auswahl zum Artikel in PAGE 04.2015.
Designer
Mariko Takagi
www.mikan.de
Florian Runge
www.cargocollective.com/florianrunge
Lisa Timpe
www.lisatimpe.de
Tarek Atrissi
www.atrissi.com
Teja Smrekar
www.tejasmrekar.com
Lisa Fischbach
www.lisafischbach.net
Ben Mitchell
www.fontpad.co.uk
František Štorm
www.stormtype.com
Daniel Sabino
www.blackletra.com
Khajag Apelian
www.debakir.com
www.maajoun.com
Titus Nemeth
www.tntypography.eu
Liron Lavi Turkenich
www.lironlavi.com
Natalie Rauch
www.natalie-rauch.net
Sebastian Losch
www.sebastianlosch.de
Alessia Mazzarella
http://www.type.land
Bon Min
www.typojanchi.org/2013/en/metamorphosis
Reiko Hirai
www.reikohirai.com
Institutionen
University of Reading, MATD-Klasse (Reading, GB)
www.typefacedesign.net/typefaces
KABK, Type and Media Masterkurs (Den Haag, NL)
www.new.typemedia.org
Multi-Script Foundries (Auswahl)
Rosetta Type Foundry (Brno, Tschechien)
www.rosettatype.com
URW++ (Hamburg, D)
www.urwpp.de
Typotheque (Den Haag, NL)
www.typotheque.com
Indian Type Foundry (Ahmedabad, Indien)
www.indiantypefoundry.com
Ek Type (Mumbai, Indien)
www.ektype.in
29LT (Beirut, Libanon)
www.29arabicletters.com
Arabic Type Today (D)
www.arabictype.com
Cyreal (Russland / Ukraine)
www.cyreal.org
Das könnte dich auch interessieren