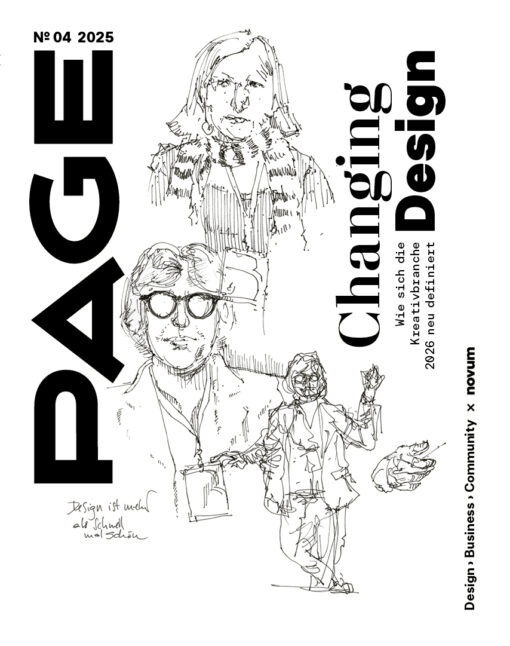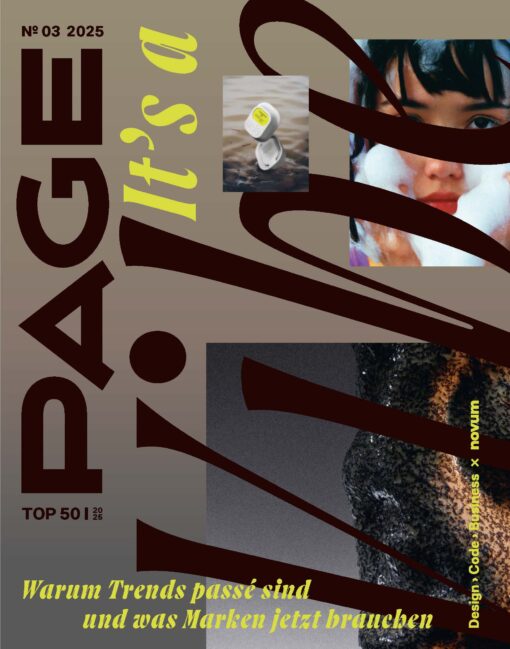Wie formen wir die Gestalterpersönlichkeiten von morgen? Das, so sagt Designbüro-Inhaber und Kommunikationsdesign-Professor Florian Pfeffer, müssen die Studenten schon selber machen. Die Hochschulen und Agenturen sollten höchstens den Rahmen dafür bieten.

Florian Pfeffer ist Partner im Designbüro one/one mit Büros in Amsterdam, Berlin und Bremen sowie Direktor der Stiftung :output in Amsterdam, die jährlich den gleichnamigen Design-Nachwuchswettbewerb auslobt. Der Kommunikationsdesigner unterrichtete von 2006 bis 2012 an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und lehrt derzeit an der Design Academy Eindhoven.
2014 erschien sein Buch »To Do: Die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt«, in dem Pfeffer sich auch Gedanken zur Ausbildungssituation in der Kreativbranche macht. Wir fragten ihn, warum Gestalter heute unternehmerisch denken können müssen und wie ein zeitgemäßes Design-Studium aussehen sollte.
Sie werfen in Ihrem Buch die Frage auf, was Design-Studenten heute lernen müssen. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Florian Pfeffer: Für den :output award habe ich in den letzten 18 Jahren rund 10 000 internationale Studentenprojekte gesichtet und kann sagen: An handwerklichen Fähigkeiten mangelt es nicht! Hier ist Deutschland im weltweiten Vergleich ganz weit vorne. Das Problem liegt eher darin, dass sich die Aufgaben von Designern und das Berufsbild sehr dynamisch entwickeln. Gestalter sind heute immer besser ausgebildet und verdienen gleichzeitig immer weniger Geld. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Was man eigentlich – oder besser: auch – an den Hochschulen lehren müsste, ist unternehmerisches Denken. Und damit meine ich keine BWL-Kurse, denn die formalen Sachen kann ein Steuerberater erledigen. Es geht vielmehr darum zu lernen, Bedürfnisse und Probleme aufzuspüren. Wir müssen neue Konzepte für unsere eigene Tätigkeit entwickeln, damit wir nicht einfach nur am Schreibtisch sitzen und darauf warten, dass Aufträge reinkommen.
»Der klassische Markt für Designer erodiert! Hier fehlt vielen Gestaltern die Flexibilität, um sich auf die neue Lage einzustellen«
Das wird im Studium nicht vermittelt?
Meines Erachtens kommt die Nachfrageorientierung oft zu kurz. Da das Studium handwerklich so stark ist, denken die Studenten oft eher angebotsorientiert: Ich beherrsche Typografie, kann Layouts gestalten, Websites bauen und suche mir jemanden, der das braucht. Aber dieser klassische Markt für Designer erodiert! Hier fehlt vielen Gestaltern die Flexibilität, um sich auf die neue Lage einzustellen. Die Fragen müssten lauten: Was brauchen Menschen wirklich? Und was kann ich dazu beitragen?
Studenten sollten sich mehr am Markt orientieren und denken wie Entrepreneure?
Wenn »Markt« die eigene Umwelt und die offenen Fragen bedeutet, die viele Menschen umtreiben: ja! Das ist auch eine Angelegenheit der Ausbildung. Je mehr Messen für Selfpublishing oder Kurse für Schriftdesign ich anbiete, desto mehr dränge ich Studenten in eine Nische, in der sie es sehr schwer haben werden zu überleben. Stattdessen müsste man mit ihnen über problemorientiertes und unternehmerisches Denken sprechen. Wenn sie heute ihr Studium beginnen, gibt es viele der Jobs noch gar nicht, die sie einmal ausüben können werden. Die entstehen währenddessen. Man muss sie also so ausbilden, dass sie dazu in der Lage sind, ihren Beruf selbst zu gestalten. Ich glaube, dann würde sich auch die Einkommenssituation wieder verbessern.
Wie lehrt man solche Fähigkeiten?
Vor allem indem man entsprechende Aufgaben stellt. Wie die alternative Schule Knowmads in Amsterdam: Die Studenten gründen zu Beginn eine GmbH und verbringen den Rest ihres Studiums damit, zu überlegen, was sie mit dieser GmbH anfangen können. Ein tolles Beispiel ist auch »Disarming Design«, ein Projekt des belgischen Büros DeVet in Kooperation mit dem Amsterdamer Sandberg Instituut und der International Academy of Art Palestine. Künstler und Designstudenten arbeiteten gemeinsam mit lokalen Handwerkern, um mit Mitteln, die vor Ort bereits vorhanden sind, neue Produkte zu entwickeln. Das Wort »Praxis« bekommt in der Realität Palästinas eine vollkommen neue Bedeutung. Solch lebensverändernde Erfahrungen helfen den Studenten dabei, eine Vorstellung davon zu entwickeln, was sie mit ihrem Designstudium alles machen können – nämlich auf der Grundlage von real existierenden Bedürfnissen und Fragestellungen funktionsfähige Modelle entwickeln.
»Wenn Designer heute ihr Studium beginnen, gibt es viele der Jobs, die sie einmal ausüben können werden, noch gar nicht«
Es geht also darum, die Studenten aus der Komfortzone holen?
Ja, denn diese Komfortzone ist gar keine mehr – sie ist zur Prekariatszone geworden. Selbstverständlich wird es weiterhin Kunden geben, die gedruckte Sachen brauchen. Aber auf Dauer wird das heutige Modell für uns alle schwierig werden. Wie man damit umgehen kann, zeigt das Beispiel von dem Produktdesignstudenten Raphael Volkmer, der sich in seiner Abschlussarbeit an der Fakultät Design & Kunst der Freien Universität Bozen mit dem Flüchtlingsproblem in Norditalien beschäftigt hat. Seine Idee lautet: Straßenhändler, die Dinge verkaufen, die niemand haben will, mit einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung zusammenbringen, die auf der Suche nach Produkten ist, die sie herstellen könnte.
Dieses Konzept setzt Raphael Volkmer jetzt unter dem Namen Nu_Volante (das bedeutet so viel wie »die neuen Fliegenden«) gemeinsam mit der Sozialgenossenschaft Akrat Recycling und Straßenhändlern aus dem Senegal um, gefördert vom Bund der Genossenschaften. Ob das funktioniert, wird sich zeigen. Aber das ist genau das, was ich mit unternehmerischem Denken meine. Zu glauben, dass die zehntausendste kleine Werbebutze funktionieren wird, ist deutlich naiver. Neues auszuprobieren bedeutet ja nicht, dass man aufhört, Designer zu sein. Es geht vielmehr darum Ideen dafür zu entwickeln, was man mit diesem Handwerk machen kann.
Um solch neue Wege zu gehen, braucht es viel Mut.
Natürlich, aber genau den braucht man für unternehmerischen Erfolg! Nach dem Studium ist die beste Zeit dafür. Die meisten haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Familie und relativ geringe Lebenshaltungskosten. Fehler tun dann noch nicht so weh. Studenten müssen generell die Angst vorm Scheitern ablegen.
Die europäischen Bildungsminister fordern, dass die Lehre sich mehr an der Wirtschaft orientieren und mit dieser zusammenarbeiten muss. Sie warnen dagegen in Ihrem Buch vor der »überstrapazierten Berufstauglichkeit« des Kommunikationsdesign- und Mediendesign-Studiums. Lehnen Sie Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen generell ab?
Keinesfalls! Wenn die Hochschulen willens sind, dafür marktübliche Honorare einzufordern, bin ich sehr dafür. Nur leider werden Hochschulen in der Realität eher zu einer Billigkonkurrenz für ihre eigenen Absolventen. Außerdem muss bei Kooperationen gewährleistet sein, dass die Studenten etwas daraus lernen. Die Aufgabe muss offen genug sein, sonst tut man den Studenten damit keinen Gefallen. Ziel des Studiums ist es, den gestalterischen Horizont zu erweitern und eine Persönlichkeit zu entwickeln. Wenn das in diesen Praxisprojekten jedoch nicht möglich ist, haben sie in der Lehre nichts zu suchen.
Auch die Idee, sich mit Auftraggebern auseinandersetzen zu müssen, ist an sich sehr gut. Aber oft handelt es sich um so kleine Budgets, dass es den Kunden letztlich egal sein kann, was dabei herauskommt. Sie verhalten sich entsprechend vollkommen anders als in der Realität, wenn es um richtige Budgets geht. Statt hilfreicher Kritik heißt es da schnell: »Danke, es ist alles toll geworden.« Wenn die Kunden aber zu lau sind, lernen die Studenten nicht, wie man sie von einem Entwurf überzeugt. Auch hier sähe es ganz anders aus, wenn die Unternehmen dafür mehr Geld ausgeben müssten. Dann wären die Erwartungen viel höher – und der Druck auf die Studenten realistischer.
Wenn Sie bei null anfangen könnten und ein grenzenloses Budget hätten: Wie würden Sie das perfekte Design-Studium für die Zukunft gestalten?
Ein fundiertes Konzept kann ich spontan nicht aus dem Ärmel schütteln. Aber es gibt ein paar Punkte, die es beinhalten müsste. Etwa Kompetenzen, die auf den ersten Blick designfern erscheinen, aber am Ende sehr viel damit zu haben, wie Moderations- und Organisationsfähigkeiten. Trainieren lässt sich das zum Beispiel, indem Studenten ihre Projekte komplett selbst organisieren müssen. Außerdem würden Aufgaben dazu gehören, die tatsächlich mit dem echten Leben zu tun haben. Keine Trockenübungen wie Erscheinungsbilder für ausgedachte Firmen, sondern Fragestellungen, die Menschen heute beschäftigen – wie bei »Disarming Design«. Solche Konfrontationen mit dem echten Leben finde ich sehr wichtig. Zum Beispiel könnte man in ein Altersheim gehen und sich anschauen, welche Probleme dort herrschen. Wenn man das einmal erlebt hat, weiß man, dass eine Aufklärungskampagne in den meisten Fällen nicht reicht.
Lesen Sie mehr zum Thema Ausbildung in der Kreativbranche in PAGE 08.2015.
Merken